Informationen zum Eichenprozessionsspinner
Aktuelle Erhebungen des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Ludwigslust-Parchim und des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V (LAGuS) zeigen eine sprunghafte Zunahme des Eichenprozessionsspinner-Befalls. Sowohl die Verbreitung der Art in der Fläche, als auch die Befalldichte – Anzahl Nester je Baum – haben in diesem Jahr ein Niveau erreicht, das in Mecklenburg-Vorpommern noch nie dokumentiert wurde. Sowohl Einzelbäume als auch einige Alleeabschnitte sind aufgrund von Starkbefall vollständig kahlgefressen. Diese Entwicklung war auf Basis der Daten der vergangenen Jahre nicht vorhersehbar, schlussfolgern die Fachleuten und sehen darin eine Trendumkehr. Ähnlich überraschende Zunahmen werden auch aus einigen Landkreisen in Brandenburg und angrenzenden Landkreisen in M-V gemeldet.
Obwohl der Kahlfraß nicht ausschließlich durch Eichenprozessionsspinner (EPS) verursacht wird, sollten betroffene Eichen möglichst gemieden werden. Dies gilt besonders bei stärkerem Wind, durch den EPS-Nester herabgeweht werden können. Durch die Nester besteht eine anhaltende Gefahr, da sich die reizenden Brennhaare der Raupen in ihnen angesammelt haben. Insbesondere bei Mäh- und Baumpflegarbeiten ist deshalb auf Nester zu achten. Auch Haustiere können betroffen sein.
Die Raupen haben Ende Juni das Puppenstadium erreicht, für das sich die Tiere in die Nester zurückziehen. In diesen erfolgt die Verwandlung zu den Faltern. Deren Schlupf und frische Eigelege, die die Grundlage für den Befall im nächsten Jahr bilden, sind Mitte bis Ende Juli zu erwarten. Das mechanische Entfernen von Nestern sollte deshalb nach Möglichkeit bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Aus Arbeitsschutzgründen sollten diese Arbeiten aber nur von Fachfirmen mit Erfahrung und Schutzausrüstung ausgeführt werden. Eine Liste mit dem Fachdienst Gesundheit bekannten Firmen sowie allgemeine Informationen zur EPS-Thematik bietet der Landkreis Ludwigslust-Parchim auf seiner Website
Aufgrund der extremen Befallszunahme werden im Frühjahr 2026 erneut umfangreichere Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich sein. Für deren Planungen erfolgt aktuell die detaillierte Daten-Auswertung. Für eine möglichst umfassende Datengrundlage bittet der Landkreis um die Meldung stark befallener Eichen. Bitte nutzen Sie dafür die allgemeine Behördennummer: 115.
Die Überwachung des Eichenprozessionsspinner-Befalls im Landkreis Ludwigslust-Parchim erfolgt jährlich durch die Erfassung von Nestern an etwa 150 Straßenabschnitten. So wurde auf Basis der Beobachtungen aus der Saison 2024 entschieden, dass – bereits im zweiten Jahr in Folge – auch in dieser Saison keine größere, zentral koordinierte Bekämpfungsmaßnahme wirtschaftlich sein würde. Eine Bekämpfung mittels Hubschrauber muss sich auf stark befallene Alleeabschnitte mit hoher Bevölkerungsexposition begrenzen, so dass für einzelne Bäume oder kleine Baumgruppen in geschlossenen Ortschaften individuelle Maßnahmen vom Boden aus ergriffen werden müssen.
Eine Auswahl von Bekämpfungsfirmen finden Sie hier.
Schutzmaßnahmen bei der Durchführung von Arbeiten im Umfeld von mit Eichenprozessionsspinnern befallenen Eichen
Was sind Eichenprozessionsspinner?
Eichenprozessionsspinner (EPS, Thaumetopoae prozessionea) sind unscheinbare Schmetterlinge, dessen Raupen sich an den Blättern von Eichen entwickeln. Seit mehreren Jahren entwickeln sich die Tiere teilweise massenhaft und treten dadurch als Gesundheits- und Pflanzenschädlinge auf. Ihren Namen erhielten die Falter aufgrund der Gewohnheit der Raupen in breiten Bändern (Prozessionen) zwischen Gespinstnestern und Eichenkronen hin und her zu laufen.
Weshalb ist der Eichenprozessionsspinner ein Gesundheits-Problem?
Ab dem 3. Larvenstadium bilden die Raupen winzige mit Widerhaken versehene Brennhaare aus. Diese nur 0,1–0,2 mm langen Härchen können nach Kontakt mit der Haut, den Augen oder durch Einatmen verschiedene Krankheitssymptome auslösen. Die häufigsten Reaktionen sind:
- stark juckende Hautentzündungen (Raupenhaardermatits), in Form von Rötungen, Bläschen oder Quaddeln, seltener kommt es zu
- Entzündungen der Augen oder
- der oberen Luftwege. Teilweise treten auch
- unspezifischen Allgemeinsymptomen wie Schwindel, Müdigkeit oder Fieber auf. In sehr seltenen Fällen kommt es zu einem allergischen Schock.
Auf welchen Zeitraum erstreckt sich die Gefährdung?
Der akute Gefährdungszeitraum beginnt ab etwa Ende Mai, wenn die EPS-Raupen das 3. Stadium erreicht haben und Brennhaare ausgebildet werden. Die Häutungsreste (und damit auch die Härchen) verbleiben in den Gespinstnestern. Da diese recht haltbar sind und die Brennhaare mehrere Jahre biologisch aktiv bleiben, erstreckt sich die Gefährdung bis in den Herbst hinein. Auch ältere Gespinstnester (zum Beispiel aus dem Vorjahr) bleiben deshalb eine mögliche Gefahrenquelle.
Wie erfolgt die Exposition?
Die Brennhaare können durch direkten Kontakt mit den Raupen oder den Gespinstnestern aufgenommen werden. Aufgrund der geringen Größe der Härchen werden diese aber auch über die Luft verfrachtet und kontaminieren so die Umgebung befallener Eichen. Alle Arbeiten, die zur Aufwirbelung der Brennhaare führen können, zum Beispiel Mäh- oder Holzpflegearbeiten sollten deshalb in betroffenen Arealen unterbleiben.
Wer ist gefährdet?
Beruflich gefährdet sind alle Beschäftigten, die in befallenen Arealen im Freien tätig sind: z.B. in der Land- und Forstwirtschaft, in Landschaftspflegebetrieben, Straßenmeistereien oder Gemeinden, in Freizeiteinrichtungen (Campingplätze, Schwimmbäder) oder Einsatzkräfte (zum Beispiel Feuerwehr).
Wie können Eichenprozessionspinner bekämpft werden?
Aufgrund der Biologie des EPS bieten sich zwei Bekämpfungsmethoden an:
- Vorbeugende Behandlung mit Insektiziden (vor dem 3. Larvenstadium)
- Mechanische Entfernung von Nestern und Raupen als Akutmaßnahme (Absaugen, Abnehmen)
Aufgrund der mit der Bekämpfung verbundenen Gefahren, sollten Maßnahmen gegen EPS nur durch spezialisierte Fachfirmen durchgeführt werden.
Weitere Angaben und Details zur Biologie, Gesundheitsgefahren und Bekämpfungsmöglichkeiten finden Sie unter folgendem Link: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=58738
Allgemeine Schutzmaßnahmen
- Grundsätzlich sind die Beschäftigten bei Auftreten der Raupen über die Gefährdung und notwendige Schutzmaßnahmen zu unterrichten
- Befallene Gebiete sollten während der Raupen- und Puppenperiode (Ende Mai bis Ende September) gemieden und Garten, Holz- und Pflegearbeiten möglichst verschoben werden
- Öffentliche Bereiche sind zu kennzeichnen, oder abzusperren
- Raupen und Gespinstnester nicht berühren, Haut- und Augenkontakt vermeiden
- Raupen und Gespinste nicht Abflammen oder mit Wasser vom Baum spritzen, dadurch werden Raupen und Härchen weiter verteilt
Maßnahmen nach Kontakt oder Kontamination
- Kleidung wechseln und getragene Kleidung gründlich waschen
- Haut und Haare gründlich waschen, duschen
- Augen mit viel Wasser spülen (zum Beispiel Augenspülflasche, besser: Trinkwasserleitung)
- Bei Beschwerden Arzt aufsuchen und diesen über EPS- Kontakt informieren
- Bei schweren allergischen Reaktionen mit Asthma und Atemnot Rettungsdienst bzw. einen Notarzt verständigen
- Juckende Hautstellen mit geeigneten Salben beruhigen, nicht aufkratzen (Infektionsgefahr!)
Spezielle Schutzmaßnahmen bei Arbeiten im Umfeld befallener Bäume und akuten Bekämpfungsmaßnahmen zur Beseitigung von Raupen und Gespinsten
Bei Arbeiten am und unter befallenen Eichen sind folgenden Maßnahmen einzuhalten:
- Verbot von Alleinarbeit
- Vor Betreten der Bereiche ist geeignete persönliche Schutzausrüstung anzulegen:
- Körperbedeckende Arbeitsschutzkleidung mit dicht schließender Kapuze (zum Beispiel Einweganzug),
- Stiefel oder Einwegüberziehstiefel,
- Schutzhandschuhe mit langer Stulpe,
- Augenschutz (zum Beispiel enganliegende Schutzbrille mit Seitenschutz),
- Atemschutz in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeit (zum Beispiel Vollmaske mit FFP 2 Filter)
- Nach Beendigung der Tätigkeiten die persönliche Schutzausrüstung an dafür vorgesehenen Stellen ablegen.
- Einwegmaterialien in stabile, verschließbare Müllsäcke überführen und einer geeigneten Entsorgung (zum Beispiel Verbrennung) zuführen.
- Anschließend sind eventuell kontaminierte Hautareale und die Haare gründlich zu waschen.
- Alle Gerätschaften und wieder verwendbare Gegenstände und Materialien mit viel Wasser reinigen, so dass keine Härchen haften bleiben.
- Das Abwasser im Kanalnetz entsorgen, nicht versickern lassen, da ansonsten eine starke Konzentration der Härchen auftreten kann.
Die Zuständigkeit für Arbeitsschutzmaßnahmen liegt beim:
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit
Friedrich-Engels-Platz 5 – 8
18055 Rostock
Ansprechpartnerin:
Frau M. Höppner
Marita.Hoeppner@lagus.mv-regierung.de
Tel.: 0385 588-59373
Internet: www.lagus.mv-regierung.de
Schutz vor einer Gefährdung durch Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners
Der Eichenprozessionsspinner, ein Nachtschmetterling, umgangssprachlich auch Motte genannt, fliegt von Ende Juli bis Anfang September. Ein Weibchen legt im oberen Kronenbereich der Eichen 100 bis 200 ca. 1 mm große Eier ab. Die Raupen schlüpfen Anfang Mai und häuten sich bis zur Verpuppung 5 - 6 mal. Mit jeder Häutung wird das Raupennest (Gespinstnest) vergrößert.
Ab dem 3. Larvenstadium, Anfang bis Mitte Mai (je nach Witterung) werden die Brennhaare (Gifthärchen) die den Giftstoff Thaumetopoein enthalten, entwickelt. Der Kontakt mit diesen Brennhaaren kann zu unterschiedlichen Beschwerden führen (Hautreaktionen, Entzündungen von Augenbindehaut und Auge, Entzündung der oberen Luftwege, mitunter auch asthmaartige Symptome und sogar Auslösung von allergischen Schockreaktionen).
Um dieses zu verhindern werden folgen Vorsichtsmaßnahmen empfohlen:
- meiden der Umgebung von befallenen Bäumen
- Raupen und deren Nester (Gespinste) nicht berühren
- empfindliche Hautbereiche (Nacken, Hals, Unterarme) mittels Kleidung schützen
- keine Durchführung von Holzernte- und Pflegemaßnahmen, wenn Raupennester erkennbar sind
- wegen der gesundheitlichen Belastung ist die Beseitigung der Raupen und deren Nester nur von Fachleuten mit spezieller Arbeitstechnik durchführen zu lassen (mechanische Bekämpfung, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln)
Wenn es zu einem Kontakt gekommen ist
- schnellstmöglich nach Hause gehen und Kleidung ablegen und ein Duschbad mit Haarreinigung nehmen, Kleidung in der Waschmaschine waschen
- betroffene Haustiere und genutzte Kraftfahrzeuge sollten ebenfalls in die Reinigungsmaßnahmen einbezogen werden
- sollte sich der Verdacht des Kontaktes durch ersten Juckreiz auf der Haut bestätigen, dann auf diese Stellen einen Klebestreifen o. ä. auf die Haut drücken und sofort ruckartig abziehen (durch das Kratzen werden die Härchen in die Haut transportiert und es kann zur Bildung von Quaddeln und Bläschen kommen)
- Beim Ernten von Obst und Gemüse oberhalb der Erdoberfläche unter bzw. in der Nähe von befallenen Bäumen sollten empfindliche Hautbereiche und die Hände geschützt werden. Dieser Schutz ist erst nach der Reinigung des Erntegutes abzulegen und zu reinigen bzw. mit dem Hausmüll zu entsorgen.
Gefahren für Haus- und Nutztiere, Tiere mit besonderer Gefährdung Weidetiere und Raufutter verzehrendes Vieh, v.a. Pferde und Rinder:
- plötzliche Schwellungen im Bereich der Nüstern bzw. des ganzen Maules, nach kurzer Zeit Ausdehnung auf gesamten Kopfbereich
- bei Rauhfutter von Wiesen in der Nähe befallener Eichen und Aufnahme von Gifthaaren im Heu : Magenschleimhautentzündungen und wie oben
Vorsichtsmaßnahmen:
- Weideabstand zu Befallseichen von mindest. 500 m
- Meidung der Befallsareale durch Reiter und Pferd
- Keine Raufuttergewinnung von wiesennahen Befallsarealen
Streunende Hunde und Katzen, Jagdhunde, Hunde mit ihren Spaziergängern:
- Kontaktdermatitis: juckende Rötungen in der Leistengegend
- Asthmatische Reaktionen
- Erbrechen weißen Schaums, persitierende Schluckbeschwerden
- Makroglossie (teilweise oder vollständige Vergrößerung der Zunge)
- Starke Schwellungen im Kopfbereich
- Nekrotisierende Glossitis (Entzündung der Zunge)
Vorsichtsmaßnahmen:
- Meidung der Befallsareale, Hauptgefährdungszeit Mai – Spätherbst
- Bei Verdacht umgehend Tierarzt konsultieren, neben Symptomschilderungen auch Angaben über Aufenthalt des Tieres in der letzten Zeit machen
- Heilung erkrankter Tiere bei rechtzeitig entsprechender tierärztlicher Therapie
EPS-Bekämpfungsmaßnahmen vom Boden
Bei der Bekämpfung vom Boden aus werden Nebelgeräte für ein zielgenaues Aufbringen des Bekämpfungsmittels eingesetzt. Bei diesem Verfahren ist der enge Zeitrahmen für einen wirksamen Bekämpfungserfolg ausschlaggebend. Eine bodengestützte Biozidmaßnahme ist allerdings zu langwierig um als Alternative für alle betroffenen Alleeabschnitte des Landkreises in Betracht zu kommen.
In den Ortschaften werden die Einsätze von den Ämtern und Städten koordiniert.
Das mechanische Absaugen der Nester der Raupen kann erst durchgeführt werden, wenn diese bereits ausgebildet sind. Zu diesem Zeitpunkt haben die Larven schon Brennhaare ausgebildet und stellen somit eine Belastung für die Bevölkerung dar.
Wer befallene Bäume auf seinem Privatgrundstück oder anderweitig entdeckt, kann sich an das örtlich zuständige Ordnungsamt wenden.
Für die Behandlung privater Bäume trägt der Grundstückseigentümer die Kosten.
Da die gesundheitlichen Gefahren durch die Raupen des Eichenprozessionsspinners nicht zu unterschätzen sind, sollte nicht versucht werden, die Nester oder einzelne Raupen zu entfernen.

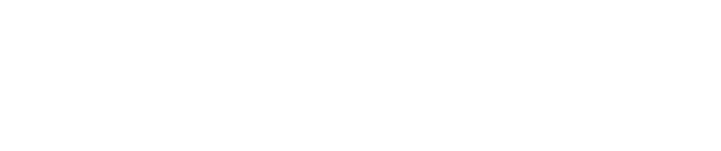
 © Kai Gloyna LAGuS M-V
© Kai Gloyna LAGuS M-V